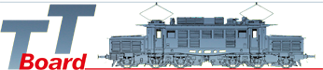App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
-
Hallo TT-Modellbahner, schön, dass du zu uns gefunden hast. Um alle Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir dir, dich anzumelden. Denn vieles, was das Board zu bieten hat, ist ausschließlich angemeldeten Nutzern vorbehalten. Du benötigst nur eine gültige E-Mail-Adresse und schon kannst du dich registrieren. Deine Mailadresse wird für nichts Anderes verwendet als zur Kommunikation zwischen uns. Die Crew des TT-Boardes
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Welle oder Achse?
- Ersteller Ralf_2
- Erstellt am
V180-Oli
Foriker
eine Wellensenke.
 Das ist dann das Wellental.
Das ist dann das Wellental.Ist aber schon wieder ganz was anderes. Da werden jetzt bestimmt paar Leute seekrank und kotzen mich voll.
Oder aber die gemeine Talsenke...

Nein, kann sie nicht. Dann wäre sie eine Welle, egal wie DU sie benennst.Natürlich KANN eine Achse auch ein Drehmoment übertragen.
Das ist ja auch das Prinzip beim Hemmschuhbremsen.
Nix überträgt Massen, nur Kräfte oder Momente (z.B. Masse x Erdbeschleunigung).Allerdings überträgt eine Welle das Drehmoment, aber keine Massen.
Häh?Deswegen selbst der Antrieb eine Achse, sofern er auch die Last des Fahrzeugs trägt.
Wo hast du denn dieses Wissen her? Selbst wenn ein Rad sein Leben lang steht, bleibt es ein Rad, wenn eine Welle (wie z.B. in der Brawa-E95 die Verbindung zwischen den Motoren) zwar dreht, aber beide Motoren von Haus aus synchron laufen, wird zwar kein Moment übertragen, es bleibt dennoch eine Welle. Daher hat die V36 4 Wellen (ohne dass Getriebe und den Motor zu berücksichtigen), egal, wie es die Betriebsbahner nennen.Es ist eine Achse.
Da die hauptsächliche Aufgabe nicht in der Übertragung eines Drehmomentes liegt, sondern in der Aufnahme des Gewichtes des Wagenkastens.
Dabei ist es völlig unerheblich, ob sich die Achse dreht oder nicht.
Als Welle wird es nur bezeichnet, wenn ihre konstruktive Aufgabe nahezu ausschließlich in der Rotation zu suchen ist.
Deswegen haben Lokomotiven mit Innentriebwerken trotzdem Achsen und die V36 3 Achsen und eine (Blind-)Welle.
Ralf_2
Foriker
Moin,
Dann versteh ich gar nix mehr.
Ich dachte bisher, die V36 hat nur eine Welle. Und die ist blind, überträgt aber artgerecht ein Drehmoment.
Grüße ralf_2
Dann versteh ich gar nix mehr.
Ich dachte bisher, die V36 hat nur eine Welle. Und die ist blind, überträgt aber artgerecht ein Drehmoment.
Grüße ralf_2
Ralf_2
Foriker
Was man aber nicht immer umkehren kann. Denn die Welt hat keine Welle, rotiert aber trotzdem…
Oder ist's am Ende doch 'ne Scheibe? An manchen Stellen sieht sie sehr flach aus.…
Grüße ralf_2
Oder ist's am Ende doch 'ne Scheibe? An manchen Stellen sieht sie sehr flach aus.…
Grüße ralf_2
lichti
Foriker
Stimmt schon, aber welches Drehmoment überträgt denn die Welle eines (klotzgebremsten) Wagenradsatzes?
Bei Loks schon, aber für die gibt es ja auch eine Wellensenke.
MfG
Im Bogen haben die beiden Radscheiben unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten. Dadurch wird die RSW neben der Biegewechselspannung auch auf Torsion beansprucht. Um die Geschwindigkeitsdifferenz so klein wie möglich zu halten, haben die Räder eben kein zylindriches Profil und der Schienenkopf ist nicht flach. Der Begriff "Achse" ist Umgangssprache.
Da Empfehle ich mal das Studium von dieser Fachliteratur....Na freilich gibt es in engen Bögen, also solchen, in denen die Differenz der von beiden Rädern zurückgelegten Wege nicht mehr durch die konische Radlauffläche ausgeglichen wird, Übertragungen des Drehmomentes von einem Rad über die Radsatzwelle zum anderen, was dann dort zu Schlupf gegenüber der Schiene führt.
Das ist aber nicht das Ziel der Konstruktion...
Auch wirst Du im der DS 984, 991 und 993, die die Instandhaltung der Radsatzwelle regelt, den Begriff "Achse" nicht finden.
Bahn120
Hersteller
@Ralf_2, das mit der Erde ist schon geklärt. Das 8. Weltwunder ist in Plauen dort wird die Erdachse geschmiert.
Ich plädiere für ein neues Wort "Wachse", es beschreibt die zusammen gelegten Eigenschaften und Funktionen von Welle und Achse.
Ist doch schön so ein Sommerloch.
mfg Bahn120
Ich plädiere für ein neues Wort "Wachse", es beschreibt die zusammen gelegten Eigenschaften und Funktionen von Welle und Achse.

Ist doch schön so ein Sommerloch.
mfg Bahn120
K. Habermann
Foriker
Guten Morgen,
ich stimme lichti in allen Punkten zu so auch in seiner Antwort dazu:
so auch in seiner Antwort dazu:
Nun, man kann streiten, ob das seinerzeit - als die Eisenbahn erfunden wurde - bewusstes Ziel der Konstruktion war. Immerhin hatten bereits die Vorläufer aus dem Bergbau konische Radlaufflächen, um eine Zentrierung des Radsatzes im Gleis zu ermöglichen. Und aus dieser Kombination
* konische Radlaufflächen
* durch "Achse" verbundene Räder
ergibt sich geringes Anlaufen der Spurkränze an die Schiene (idealerweise haben die gar keinen [seitlichen] Kontakt mit der Schiene) und daraus folgend
* Laufruhe
* geringer Verschleiß.
Das heißt, die Radsatzwelle bewirkt über Drehmomentübertragung den Ausgleich der Drehzahldifferenzen links und rechts.
Das Gegenteil kann man bei Einzelradlaufwerken spüren. Der Vergleich beider Systeme kann bei den Dresdner Verkehrsbetrieben und ihren beiden Generationen Niederflurtriebwagen, wo die neueren wieder klassisch mit Radsätzen gebaut sind, erlebt werden.
Beste Grüße
Klaus
ich stimme lichti in allen Punkten zu
Na freilich gibt es in engen Bögen, also solchen, in denen die Differenz der von beiden Rädern zurückgelegten Wege nicht mehr durch die konische Radlauffläche ausgeglichen wird, Übertragungen des Drehmomentes von einem Rad über die Radsatzwelle zum anderen, was dann dort zu Schlupf gegenüber der Schiene führt.
Das ist aber nicht das Ziel der Konstruktion.
Nun, man kann streiten, ob das seinerzeit - als die Eisenbahn erfunden wurde - bewusstes Ziel der Konstruktion war. Immerhin hatten bereits die Vorläufer aus dem Bergbau konische Radlaufflächen, um eine Zentrierung des Radsatzes im Gleis zu ermöglichen. Und aus dieser Kombination
* konische Radlaufflächen
* durch "Achse" verbundene Räder
ergibt sich geringes Anlaufen der Spurkränze an die Schiene (idealerweise haben die gar keinen [seitlichen] Kontakt mit der Schiene) und daraus folgend
* Laufruhe
* geringer Verschleiß.
Das heißt, die Radsatzwelle bewirkt über Drehmomentübertragung den Ausgleich der Drehzahldifferenzen links und rechts.
Das Gegenteil kann man bei Einzelradlaufwerken spüren. Der Vergleich beider Systeme kann bei den Dresdner Verkehrsbetrieben und ihren beiden Generationen Niederflurtriebwagen, wo die neueren wieder klassisch mit Radsätzen gebaut sind, erlebt werden.
Beste Grüße
Klaus
So auch in FFM.Der Vergleich beider Systeme kann bei den Dresdner Verkehrsbetrieben und ihren beiden Generationen Niederflurtriebwagen, wo die neueren wieder klassisch mit Radsätzen gebaut sind, erlebt werden.
Ähnliche Themen
- Antworten
- 10
- Aufrufe
- 1K
- Antworten
- 20
- Aufrufe
- 6K
- Gesperrt
- Antworten
- 9
- Aufrufe
- 3K
- Antworten
- 49
- Aufrufe
- 7K