App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
-
Hallo TT-Modellbahner, schön, dass du zu uns gefunden hast. Um alle Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir dir, dich anzumelden. Denn vieles, was das Board zu bieten hat, ist ausschließlich angemeldeten Nutzern vorbehalten. Du benötigst nur eine gültige E-Mail-Adresse und schon kannst du dich registrieren. Deine Mailadresse wird für nichts Anderes verwendet als zur Kommunikation zwischen uns. Die Crew des TT-Boardes
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ludmilla - BR 232-Nachfolger geht in Serie!
- Ersteller Dieselpower
- Erstellt am
Erni
Gesperrt
Hallo,
man soll nicht vergessen, daß Siemens den ER 20 als 6achsige Version bringt mit einer neuen Drehgestelltechnick und in der Traxx-Familie tut sich auch so einiges. Die Bahn wird, wenn sie Dieselloks braucht sie in Deutschland kaufen.
Gruß Erni
man soll nicht vergessen, daß Siemens den ER 20 als 6achsige Version bringt mit einer neuen Drehgestelltechnick und in der Traxx-Familie tut sich auch so einiges. Die Bahn wird, wenn sie Dieselloks braucht sie in Deutschland kaufen.
Gruß Erni
Dieselpower
Foriker
Kannste die Rechnung mal bitte erklären? Soweit ich weiß, liegt der Punkt mit geringstem spezifischem Kraftstoffverbrauch (und nur dieser Wert wird genannt) weit ab vom Punkt "Vollgas" (Wo liegt der eigentlich? Volllastlinie sagt mir was,aber ein Punkt kann sich nur als Gleichgewicht zu einemVerbraucher einstellen.). Über Verluste im weiteren Antriebsstrang ist gar keine Aussage getroffen. So einfach ist die Rechnung also nicht.
Die einzigste Rechnung, die möglich ist: Wieviel mechanische Energie kann der Verbrennungsmotor im Verbrauchsoptimum aus den 7000l Kraftststoff erzeugen. Der Rest bleibt ohne detailiertes Moterenkennfeld und Wirkungsgradkennfelder der weiteren Antriebselemente Spekulatius.
Die Kraftstoffangabe bezieht sich in der Regel auf den Volllastbetrieb. Die Lok bringt bei 3100 kW Motorleistung etwa 2550 kW an die Schiene. Für nen schweren Güterzug mit 2000 t kannst man überschlagsmäßig etwa 5 l/km als Verbrauch annehmen. Der Tank sollte aber nicht weiter als auf minimal 500 l heruntergefahren werden. Macht also etwa 1300 km Reichweite im schweren Güterverkehr oder 9,5 Stunden Volllastfahrt fahren bis man wieder Tanken sollte.
Zum Thema "Schienenfräse" das für die 232 öfters mal bebraucht wird. Man hat das ganze nach der Wende bei der DB mal untersucht. Heraus kam dabei, daß die Lok bis 80 km/h, auf gut verlegten Gleisen bis 100 km/h recht oberbauschonend ist. Erst oberhalb von diesen Geschwindichkeiten ist sie dies wegen ihres Tatzlagerantriebes nicht mehr. Bei Railion mit max 90 km/h spielt diese aber keine große Rolle mehr.
Die Drehgestelle der 232 sind ja an sich ne recht moderne Konstruktion mit elastischer Radsatzlagerung, kurzem Radstand und zudem sind alle Achsen seitenverschiebbar.

ps: Ich kenne übrigens ne ganze Menge von "Bundesbahnopis" die die 232er aufgrund ihrer Leistung und ihres relativ hohen Komforts sehr schätzen und nicht mehr gegen die BR 218 & Co tauschen wollen. Ist alles eine Frage der Eingewöhnung.

Spitznamen der Loks im Süden sind übrigens "Russischer Großdiesel" für die 232 und "Hilfsdiesel" für die 218. Das sagt wohl einiges über die Wertschätzung der jeweiligen Lok. Also nicht alles verallgemeinern.

Peo
Gesperrt
Kannste die Rechnung mal bitte erklären? Soweit ich weiß, liegt der Punkt mit geringstem spezifischem Kraftstoffverbrauch (und nur dieser Wert wird genannt) weit ab vom Punkt "Vollgas" (Wo liegt der eigentlich? Volllastlinie sagt mir was,aber ein Punkt kann sich nur als Gleichgewicht zu einemVerbraucher einstellen.). Über Verluste im weiteren Antriebsstrang ist gar keine Aussage getroffen. So einfach ist die Rechnung also nicht.
Die einzigste Rechnung, die möglich ist: Wieviel mechanische Energie kann der Verbrennungsmotor im Verbrauchsoptimum aus den 7000l Kraftststoff erzeugen. Der Rest bleibt ohne detailiertes Moterenkennfeld und Wirkungsgradkennfelder der weiteren Antriebselemente Spekulatius.
Da keine weiteren Angaben vorlagen, hier die Rechnung:
3100 KW/194(g/KWh) = ca. 600 /h
7000 l / 600 (l/h) = 11,67 h
11,67 h * 160 km/h = ca 1870 km
Da Diesel bekanntlich etwas leichter als 1000g/l ist, habe ich mal abgerundet.
Verluste durch Reibung usw. interessieren nicht, da der Dieslmotor nur 3,1MW schafft, ob da 2 W oder 2 MW an Reibung oder Lufwiderstand verschwinden, ist egal, denn er schafft laut Hersteller 160 km/h.
Das Ganze war ein Überschlag, und wenn dieser Wert für das Motorenoptimum gilt, dann ist die Reichweite der Lok in diesem Optimum sogar noch höher, da der Verbrauch normalerweise überproportional zur Geschwindigketi steigt.
mfg
Peo
Jan
Boardcrew
Mühldorf erstetzt ja mittlerweile seine 217er Päärchen durch Großrussen (233).
s51driver
Gesperrt
Bei Railion mit max 90 km/h spielt diese aber keine große Rolle mehr.
Da frag ich mich allerdings, wieso die BR 231 so fix ausgemustert wurde, wo sie doch für den Geschwindigkeitsbereich besser ist, als die BR 232. Versteh mal einer die Bahn.
Gibt's eigentlich weitere 232er (neben V300 001 - V300 003 Wismut) die die 100km/h Drehgestelle der 231 bekamen?
Axel
Die 231 war eine reine Güterzuglok, welche nur im Sommer für den P-Verkehr geeignet war, weil sie ja keine Zugheitzung hatte. Die 232 hatte aber sowas und als die Ausmusterungswelle war, war ja nochnicht Abzusehen, das es mal zu soeiner Aufteilung kommt, welche jetzt vorhanden ist.
Das halte ich mal für ein Gerücht. Im Motorenbau wird üblicherweise der Bestpunkt des spezifischen Kraftstoffverbrauchs genannt. Weiterhin ist die Frage: Was ist Volllastbetrieb? In Motoren-/Verbrauchskennfelder kenne ich die Vollastkennlinie, die den Arbeitsbereich eines Dieselmotors nach "oben" deckelt, also Mmax(n) kennzeichnet. Die Leistung ist aber von M und n abhängig, so dass auch bei Volllast nicht die Nennleistung erreicht werden muss.Die Kraftstoffangabe bezieht sich in der Regel auf den Volllastbetrieb.
Gibt es irgendwo ein Verbrauchskennfeld des betreffenden Motors? (Würde mich stark wundern.)
@ Peo:
Schon klar dass die Rechnung nur mal grob gemacht wurde, aber mit meinem Hintergrundwissen standen mir gleich die Nackenhaare zu Berge. Nur leider hast du gleich in der ersten Zeile einen kleinen Fehler:
Im Punkt des Verbrauchsoptimums leistet der Motor mit Sicherheit keine 3100 kW sondern deutlich weniger. Der Nennpunkt des Motors im M-n-Kennfeld ist "irgendwo oben rechts", der Bereich minimalen Kraftstoffverbrauchs grob bei 1/3 nnenn. Somit wäre die Leistung grob überschlagen nur noch 1000 kW.3100 KW/194(g/KWh) = ca. 600 /h
Bei einer möglichen Leistung des Verbrennungsmotors von 1000 kW spielen Wirkungsgradverlust und Luftwiderstandkräfte bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h doch eine nicht unerhebliche Rolle. Wobei die Leistung bei Alleinfahrt der Lok noch für 160 km/h ausreichen sollte und somit die dreifache (s.o) Reichweite erzielen.Verluste durch Reibung usw. interessieren nicht, da der Dieslmotor nur 3,1MW schafft, ob da 2 W oder 2 MW an Reibung oder Lufwiderstand verschwinden, ist egal, denn er schafft laut Hersteller 160 km/h.
Bei artgerechter Haltung sollte die Lokomotive auch noch etwas mehr als nur sich selbst mit Hg durch die Gegend fahren, wodurch eine Reichweite von 2000 ... 2500 km problemlos machbar sein könnte.Das Ganze war ein Überschlag, und wenn dieser Wert für das Motorenoptimum gilt, dann ist die Reichweite der Lok in diesem Optimum sogar noch höher, da der Verbrauch normalerweise überproportional zur Geschwindigketi steigt.
Interessant ist an dem Konzept, dass man quasi eine Universallokomotive baut. Das ist aber in Deutschland nicht so "beliebt", siehe Aufteilung/Zuordnung verschiedener Bauarten typenrein zu jeweils einem Unternehmen der DBAG und welche Problemchen es bereiten kann, wenn mal eine Lok kurzfristig aus einem anderen Geschäftsbereich nötig ist.
Jan
Boardcrew
Das ist aber ein administratives Problem, kein technisches. Die Andere Frage ist, ob es sinnvoll ist, teure/aufwändige Hochgeschwindigkeitstechnik im langsamen GV zu verwenden. Die DBAG hat sich mit der Abkehr von der Universallok 121 hin zu spartenspezifischen Lösungen dagegen entschieden. Die ÖBB hat mit dem Taurus eine Universallok beschafft.
Bei den irgenwann fälligen Ersatzbeschafungen scheint sich die DBAG noch nicht einig zu sein. Hier geht es ja rein/raus in die Kartoffeln (Auschreibungen).
Bei den irgenwann fälligen Ersatzbeschafungen scheint sich die DBAG noch nicht einig zu sein. Hier geht es ja rein/raus in die Kartoffeln (Auschreibungen).
H-Transport
Boardcrew
Hallo!
Ich bin der Meinung, nachdem was ich bisher gesehen habe, sind spezifische Fahrzeuglösungen ab einer Stückzahl von 50 - 75 Loks pro Sorte sinnvoller. Die Wartungs- und Schulungskostenzuschläge sind dann deutlich günstiger als die zusätzlichen Aufwendungen durch die Anschaffung der Technik. Nicht zuletzt haben auch die Hersteller durch das Schaffen von Fahrzeugplatformen auch darauf hin gearbeitet. Dadurch kann man die Auswirkungen durch die Unterschiede deutlich nach unten schrauben.
Es wird sich auch keiner von uns ein Gerät anschaffen, was er nie in seiner vollen Funktionsbreite benötigt, wenn er es viel einfacher haben kann. Oder um der Frage nachzugehen, warum ein Singlehaushalt keine vollautomatische 15.000 Euro-Kaffeemaschine braucht - nicht das man ihm diese nicht einreden könnte... .
Daniel
Ich bin der Meinung, nachdem was ich bisher gesehen habe, sind spezifische Fahrzeuglösungen ab einer Stückzahl von 50 - 75 Loks pro Sorte sinnvoller. Die Wartungs- und Schulungskostenzuschläge sind dann deutlich günstiger als die zusätzlichen Aufwendungen durch die Anschaffung der Technik. Nicht zuletzt haben auch die Hersteller durch das Schaffen von Fahrzeugplatformen auch darauf hin gearbeitet. Dadurch kann man die Auswirkungen durch die Unterschiede deutlich nach unten schrauben.
Es wird sich auch keiner von uns ein Gerät anschaffen, was er nie in seiner vollen Funktionsbreite benötigt, wenn er es viel einfacher haben kann. Oder um der Frage nachzugehen, warum ein Singlehaushalt keine vollautomatische 15.000 Euro-Kaffeemaschine braucht - nicht das man ihm diese nicht einreden könnte... .

Daniel
Dieselpower
Foriker
Das halte ich mal für ein Gerücht. Im Motorenbau wird üblicherweise der Bestpunkt des spezifischen Kraftstoffverbrauchs genannt. Weiterhin ist die Frage: Was ist Volllastbetrieb? In Motoren-/Verbrauchskennfelder kenne ich die Vollastkennlinie, die den Arbeitsbereich eines Dieselmotors nach "oben" deckelt, also Mmax(n) kennzeichnet. Die Leistung ist aber von M und n abhängig, so dass auch bei Volllast nicht die Nennleistung erreicht werden muss.
Gibt es irgendwo ein Verbrauchskennfeld des betreffenden Motors? (Würde mich stark wundern.)
Bei Eisenbahndieselmotoren wird immer, wenn nicht ausdrücklich anderst angegeben der Verbrauch des Motors unter voller Leistung angegeben, in diesem Fall bei 3100 kW. Der Volllastverbrauch dieser Lok liegt mit D49-Motor somit bei rund 600 kg oder 700 l Diesel je Stunde. Rechnet man also die 500 l Restvolumen im Tank zurück bleiben effektiv 6500 l zum "Verfeuern", was etwa 9,3 Stunden Volllastbetrieb entspricht.
Als kleine Rechenspielerei dazu. Die installierte Leistung der TEP150 ist ausgelegt für die Beförderung von 600 t schweren Schnellzügen mit 160 km/h auf ebener Strecke. Macht mit einem solchen Zug etwa 4,4 l Verbrauch auf den km bei konstant 160 km/h. Sollte die TEP150 damit 9,3 h voll "durchbrennen" wäre damit eine Reichweite von knapp 1500 km drin.
Ist zwar nicht besondert realistisch das Beispiel aber man bekommt wenigstens eine Vorstellung über den Verbrauch.
In der Praxis dürfte die TEP150 mit einem 600 t schweren Reisezug somit etwa 4-5 l je km verfeuern, je nach Strecken- und Geschwindichkeitsprofil sowie der Häufigkeit der Anfahrten. An sich ein sehr günstiger Wert, vor allem wenn man bedenkt wieviele Menschen in einen 600 t-Reisezug passen

H-Transport
Boardcrew
600t (12 Wagen) Könnten locker 700 Sitzplätze sein, was einem Verbrauch von 0,7 - 0,8l auf 100 km pro Person bedeutet. Wenn das nichts ist 
Daniel
Daniel
Jan
Boardcrew
Hallo Daniel,
prinzipiell gebe ich Dir recht, was die Kostenredundanz durch Plattformkonzepte betrifft. Anderseits sollen/müssen die Loks wohl wieder 25-35 Jahre halten und wer weiß schon was sich in dieser Zeit alles ändert.
Einen Eurorunner zum Beispiel gibt in verschiedenen Varianten, darunter auch eine abgespeckte Cargoversion ohne ZEV.
prinzipiell gebe ich Dir recht, was die Kostenredundanz durch Plattformkonzepte betrifft. Anderseits sollen/müssen die Loks wohl wieder 25-35 Jahre halten und wer weiß schon was sich in dieser Zeit alles ändert.
Einen Eurorunner zum Beispiel gibt in verschiedenen Varianten, darunter auch eine abgespeckte Cargoversion ohne ZEV.
Jan hat etwas von Doppeltrak. 217 in Mü(h)lldorf geschrieben. Wäre es nicht viel billiger wenn man die BR 232/233 weiter im Einsatzplan lassen würde? Denn die zwei 217 verbrauchen mehr als ein Russe.
Auch die Verschleißkosten steigen dadurch.
Martin
Auch die Verschleißkosten steigen dadurch.
Martin
Jan
Boardcrew
Ich schrobselte doch, das hier remotorisierte 233er Großrussen die 217er Päärchen ersetzen...
Bei Railion mit max 90 km/h ...
Da muß ich dir leider widersprechen.
Güterzüge mit Vmax 90 km/h sind schon selten geworden.
Railion und auch viele Private EU fahren mittlerweile viele Züge mit 100 km/h und noch schneller. Die PIC mit 160 km/h sind dabei die Ausnahme.
Die schnellsten Güterzüge bei uns sind z.B. IKE 50297 Maschen Rbf - Frankfurt/Oder mit Übergang zur PKP. Vmax 120 km/h, 1300 t Last (Container)und bespannt mit BR 145. Die Gegenleistung IKE 50296 Frankfurt/Oder - Maschen Rbf hat sogar 1500 t Buchfahrplanlast und die Züge sind in der Regel ausgelastet.
Mathias
Die Bahn wird, wenn sie Dieselloks braucht sie in Deutschland kaufen.
Jawoll!!!
Bei der Lokomotivschmiede Krauss-Maffei in München.
 (jetzt Siemens TS)
(jetzt Siemens TS)In der gleichen Stadt sitzen glaube ich auch die entsprechenden Bahn-Einkäufer.
@Eurofima: Da hab ich so meine Zweifel dran. Die Bahn AG ist ja im Moment ganz scharf auf Bombardier. Da ist ja nun doch ein deutliches Ungleichgewicht bei den bestellten Stückzahlen zu sehen. (ca. 400 Bombardier-Loks stehen ca. 200 Siemens-Maschinen gegenüber). Die letzten Siemens-Loks wurden im Dezember 2005 abgenommen (189 100-1). Bei Bombardier wird immernoch fleißig ausgeliefert, es fehlen allein noch über 100 Loks der Reihe 185. Danach geht's (sicher) mit der 186 weiter, bzw. beginnt die Lieferung parallel.
H-Transport
Boardcrew
Schauen wir mal, wie die Bombardier-Testfahrten enden. Ich finds gut, dass diesmal nicht die Bahn die Erprobung und die aus meiner Sicht erwartete Standfestigkeitssicherung im Betrieb übernehmen muß, sondern auch mal jemand anders.
Die vorübergehende Abkehr von Siemens ist für mich nicht weiter verwunderlich ... .
Alstom hat auf der Prima-Basis auch eine Diesellok im Angebot, die funktioniert - mit ordentlicher Lackierung auch weniger streitbar als das Fretchen.
Grüße
Daniel
Die vorübergehende Abkehr von Siemens ist für mich nicht weiter verwunderlich ... .
Alstom hat auf der Prima-Basis auch eine Diesellok im Angebot, die funktioniert - mit ordentlicher Lackierung auch weniger streitbar als das Fretchen.
Grüße
Daniel
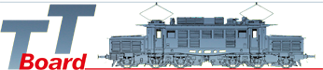
 @Stolli "Bundesbahnopis" würd ich zum Board-Unwort des Jahrees küren. Sehr gut! Eine Umfrage wäre nicht schlecht.
@Stolli "Bundesbahnopis" würd ich zum Board-Unwort des Jahrees küren. Sehr gut! Eine Umfrage wäre nicht schlecht.