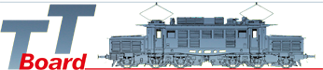und hier mal noch etwas unnützes Wissen:
Normalspur – und wie sie entstand
Als im 19. Jahrhundert erste Eisenbahnen in der Wirtschaftsnation Nummer 1 Großbritannien aufkamen, musste auch die Spurweite festgelegt werden. Für Kutschen gab es bereits ein Gesetz, welches die Spurweite und die Kutschenbreite festlegte. Hintergrund war das sich ab dem 16. Jahrhundert entwickelnde Postkutschennetz und die vorhandenen Straßen. Diese basierten meistens auf alten Straßen der Römer, welche diese für ihre Wagen auslegten. Im römischen Reich war alles normiert, um alles in Serien und somit billig und austauschbar herstellen zu können. Die Römer erkannten und nutzten auf ihren Kriegszügen nicht nur die Normierung ihrer Streitkräfte, die klar in Gruppen zu 10 Personen (Decenturion) eingeteilt waren. 10 Decenturionen ergaben eine Centurion und so weiter. Dies ermöglichte es flexibel auf sich ändernde Verhältnisse auf dem Schlachtfeld zu reagieren. Die Centurionen waren untereinander austauschbar. Alles war dabei normiert, wie die Größe der Schilde, die Länge der Schwerter (römisches Kurzschwert), die Bauart und Größe der Lanzen, die Rüstungen.
Als die Legionen erstmals auf Streitwagen trafen, erkannten die Römer deren Vorteile und übernahmen und normierten auch sie. Auf dem Wagen musste der Wagenlenker und ein Bogenschütze Platz finden. Der Wagen wurde von zwei davor nebeneinander laufenden Pferden gezogen. Und genau die bestimmten deshalb die Normbreite der Wagen, also deren normierte Spurweite. Die heutige Normalspur der Bahn ist somit die Normbreite von zwei nebeneinander laufenden römischen Pferdeärschen (kein Witz).
Die römischen Straßen wurden so gebaut, dass zwei Streitwagen auf ihr problemlos aneinander vorbei kamen. Die Spurbreite der römischen Streitwagen wurde in Folge dessen auch zur Spurweite der römischen Pferdewagen und ersten römischen Kutschen. Für diese Spurbreite wurden in den Straßen mitunter regelrecht Rillen eingebaut, in denen die Wagen „wie auf Schienen“ spurtreu liefen. Dies geschah in erster Linie auf Brücken und in Toreinfahrten, wo Abweichungen von der zugewiesenen Spur den Gegenverkehr stark behindern würden, da er dort nicht ausweichen konnte. Jedoch bildeten sich diese Rillen auch vielerorts von allein durch die jahrhundertelange Benutzung der Römerstraßen.
Mit dem Niedergang des römischen Reiches ging viel Wissen verloren, jedoch blieben die Spurrillen in den alten Römerstraßen bestehen, weshalb auch tausend Jahre später noch immer alle Fuhrwerke in England genau diese Spurweite hatten. Abweichungen davon hätten in den Rillenstrecken zum Radbruch geführt.
Lange Zeit waren die ungefederten Kutschen und Karren nichts, womit man gerne unterwegs war. Als man im 15. Jahrhundert in Ungarn aber die Federung, welche die Römern schon ab dem 2. Jahrhundert in ihren Kutschen verwendeten, wieder entdeckte, wurden Kutschen als Reisefahrzeug wieder interessant. Als dann auch noch der Weg von der Aufhängung an vier Lederriemen hin zur Federmetallaufhängung erfolgte, boten Kutschen auch einen gewissen Reisekomfort. Schnell wurden Kutschen zum Statussymbol und sie wurden immer größer und breiter (irgendwie hat sich daran bis heute nichts geändert). Dies führte jedoch zu Problemen, da die alten Römerstraßen dafür nicht breit genug waren, wenn sich diese breiten Kutschen mit normalen Fuhrwerken dort trafen. Hier schritt der englische König ein und legte die Spurbreite der Kutschen und Karren nun endgültig fest und damit auch gleich die maximale Breite der Kutschen insgesamt, da die Räder damals der breiteste Teil der Kutschen waren.
Als dann im 19. Jahrhundert erste Eisenbahnstrecken gebaut wurden, orientierte man sich an den Normen für Straßenfahrzeuge, also an Kutschen. Die Landbesitzer Englands waren von der Bahn alles andere als begeistert. Die Lords hatten gerade erst neue Wasserstraßen gebaut bzw. deren Bau in Auftrag gegeben und wollten keine Konkurrenz durch die Bahn, also wurde diese möglichst schikaniert und eingebremst. Landvermesser für neue Bahntrassen wurden von ihnen regelrecht verjagt und behindert, wo es nur ging. Man erinnerte sich daran, dass für Straßenfahrzeuge bereits eine königliche Norm existierte und bestand auf deren Einhaltung. Das die Schienenwege gerade neu gebaut wurden und schon deshalb wesentlich größere Lichtraumprofile möglich waren als auf den alten Römerstraßen wurde erst mal vernachlässigt. Die Leichter auf den Kanälen waren nämlich schon damals nicht gerade groß. Aus Kostengründen wurden die Kanäle nur so breit gebaut, dass sich zwei Boote darin begegnen konnten, die Schleusen boten gar nur einem Boot Platz. Deshalb mussten die Boote schmal sein. Die Norm wurde 1750 auf das Narrowboat festgelegt, welches zwar bis zu 22 m lang, aber bis heute nur bis 2,20 m breit sein darf. Damit waren die Boote auf eine Ladung von ca. 25 t festgelegt. Nur, die Industrie entwickelte sich weiter. Die Transportkapazität von 1750 genügte der Industrie fünfzig Jahre später z.B. in Manchester nicht mehr. Es wurden leistungsfähigere Transportmittel zu den Häfen und den Kohlevorkommen für die Dampfmaschinen gebracht, die zudem vom Wetter unabhängig sein sollten. Die Wasserstraßen waren unzuverlässig, froren im Winter zu und trockneten im Sommer aus. Die Landbesitzer hatten jedoch gerade bedeutende Kanalbauprojekte umgesetzt oder initiiert, welche sich nun erst mal rechnen mussten, also Gewinn einfahren sollten. Deshalb versuchten sie die Bahn klein zu halten, um ihre Transportkapazität zu begrenzen. Dies umgingen die Bahngesellschaften, in dem sie den Landbesitzern Anteile am Gewinn der Bahnen vertraglich zusicherten. Um weitere Rechtstreitigkeiten zu vermeiden, wurden jedoch die Kutschenmaße eingehalten.
Wie weit die Landbesitzer mitunter gingen sieht man auch daran, wie sie sich ab den 1830er Jahren nun gegen die Konkurrenz zur Bahn auf den Straßen zur Wehr setzten. Die damals aufkommenden Kraftomnibusse mit Dampfmaschinenantrieb entwickelten sich zu einer ernsten Konkurrenz zu der auf teure Schienenwege angewiesenen Bahn, an der die Landbesitzer nun Anteile hatten. Ein solcher Dampfwagen beförderte bis zu 17 Personen auf normalen Straßen viel schneller als jede Pferdekutsche. Die Lords setzten im Parlament ein Gesetz durch, in Folge dessen vor jedem Dampfwagen eine Person mit roten Fahnen herlaufen musste, um den Dampfwagen anzukündigen, damit sich jeder Fußgänger und Kutschenlenker auf dessen Ankommen vorbereiten konnte. Das reduzierte dessen Geschwindigkeit auf 4 km/h und führte zu seinem Aus, da jede Postkutsche nun wieder schneller war.






 leverkusen.rheinische-industriekultur.com
leverkusen.rheinische-industriekultur.com